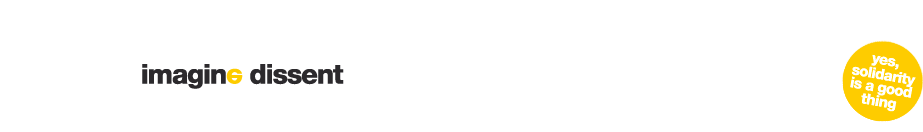Von Bilderkriegen und Kriegerbürgern
in Zusammenarbeit mit: Cecil Arndt, ak – analyse&kritik.Zeitung für linke Debatte und Praxis
wann: 2009
was: -
als: Zeitungsartikel
Download als PDF
(Nichts) Neues von der Heimatfront
Militärische Intervention durchdringt nicht nur unsere Wirtschaftsbeziehungen und unseren Alltag, sondern auch das SelbstBewusstsein jedes/jeder Einzelnen und damit das kollektive Bewusstsein, auf dem die Kriegsfähigkeit der Gesellschaft gründet. Diese „Neue Heimatfront” scheint sich vor allem dadurch auszuzeichnen, dass sich die Einzelnen kaum mehr in ein Verhältnis zu den in ihrem Namen geführten Kriegen setzen (müssen). Die Konstituierung jener „Neuen Heimatfront” ist dabei zentral auf die (Re-)Produktion wiedererkennbarer und interdiskursiv verschränkter Bilder verwiesen, die unser Verständnis von Krieg und Frieden, Ausnahme und Normalzustand bestimmen. Angesichts der neuerlichen Militarisierung westlicher Gesellschaften und des Ausbleibens breiter Gegenbewegungen stellt sich die Frage, wie wir uns als (z.B. „weiße, männliche, abendländische/deutsche”) Subjekte durch diese Bilder und Techniken innerhalb eines, nur noch zum Teil als solcher erkennbaren, Kriegsdiskurses konstituieren. Eine antimilitaristische Auseinandersetzung mit der Frage, in welchem Verhältnis dieses Subjekt zu Kriegen steht, die in seinem Namen geführt werden (können), ist damit Teil einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung, die zur Zeit vermutlich weder allein durch Aufklärung noch durch Militanz zu entscheiden ist.
Genremalerei in Kunduz – Kontinuitäten im Kriegsbild
Unser Verständnis von Krieg ist Resultat vieler Jahrhunderte gesellschaftlicher Vermittlung, Deutung und Verklärung. Aus der Schlachtenmalerei der Renaissance entwickelten sich erste, bis heute wirksame visuelle Deutungsmuster. Die ökonomische Abhängigkeit der Künstler führte dazu, dass sie die Schlachten im Sinne ihrer Auftraggeber imaginierten, also entweder militärische Erfolge überzeichneten oder Niederlagen umdeuteten. Parallel zur „historischen” Schlachtenmalerei entwickelte sich mit der militärischen Genremalerei eine neue Darstellungsform, die sich in Folge des Dreißigjährigen Krieges (1618–1648) enormer Beliebtheit erfreute. Hierzu zählte die Visualisierung von „Krieg an sich”: Das „künstlerisch Erregende” des Kampfes und kriegerische „Randerscheinungen” wie Plünderungen oder Trinkgelage von Soldaten und mitreisenden MarketenderInnen.
Nachdem jene Genredarstellungen zunächst den soldatischen Stand als von anderen gesellschaftlichen Ständen abgegrenzt vermittelten, knüpfte die Genremalerei im 19. Jahrhundert an die Verbürgerlichung des Militärischen und entsprechende Bildwelten an. Einschreibungen bürgerlich-humanistischer Wertvorstellungen verbanden sich hier kitschig-grotesk mit romantischer Landschaftsmalerei. Das Genre Militaire kam dem Zeitgeschmack letztlich näher als die marginalen künstlerischen Versuche, Francisco de Goyas oder später Wassili Wereschagins, den Charakter von Krieg in aller Konsequenz zu ergründen.
Mit dem Genre Militaire etablierte sich eines der bis heute wirksamen Deutungsmuster, das sich auch in den gegenwärtigen Bildern vom soldatischen Alltag „unserer” Soldaten in Afghanistan widerspiegelt. Z.B. bedienen die Bilder von heute einerseits die Vorstellung bürgerlich-militärischer Ordnungsprinzipien im Krieg („Waschtag im Feldlager Kunduz”). Andererseits inszenieren sie demonstrative Freundlichkeit gegenüber einer als potenziell immer gefährlich vermittelten Bevölkerung als zivilisatorisches Überlegenheitsprinzip.
„Nie wieder Auschwitz!“: Public Relations (PR) als PostPropaganda
Propaganda war im Gegensatz zu PR zumeist klar als solche identifizierbar, was Rückschlüsse auf Autorschaft und zentrale Lenkung erlaubte. PR dagegen verfügt über die Macht, Wahrheiten zu konstituieren, indem sie unsere realitätskonstituierenden Instanzen bedient, wobei die Urheberschaft zumeist im Verborgenen bleibt. So galt beispielsweise während des Zweiten Golfkrieges und darüber hinaus: »Irakische Soldaten ermorden kuwaitische Säuglinge.« Die so genannte „Brutkastenlüge“ und deren mediale Inszenierung war Produkt der PR-Firma Hill & Knowlton (HK), wobei sie nur der Höhepunkt einer größeren Kampagne war, deren Basis Citizens for a free Kuwait bildete. Die AktivistInnengruppe, ebenfalls eine Erfindung von HK, war derart real, dass sie in einigen US-Bundesstaaten gar erfolgreich einen offiziellen Feiertag für ein freies Kuwait einforderte.
Mit dem wenige Jahre darauf folgenden Kriegseintritt der Bundeswehr in den Jugoslawienkrieg und der damit Verbundenen Inszenierung eines „neuen Holocaust” auf dem Balkan pervertierte die deutsche Kriegspolitik alle sinnvollen Lehren, die sich aus deutscher Geschichte ziehen ließen, zugunsten einer wirkungsvollen PR-Strategie: Der Instrumentalisierung des Leids anderer.
Von Beginn des Jugoslawienkrieges an wurden Bilder veröffentlicht, die eine Verbindung zwischen den Praktiken serbischer Akteure und NS-Verbrechen nah legten. Ein Bild avancierte zum Sinnbild der geistigen Mobilisierung uns weckte unweigerlich Assoziationen zu den im kollektiven Gedächtnis verankerten Bildern der Befreiung deutscher Konzentrationslager: Ein ausgemergelter Mann mit nacktem Oberkörper hinter Stacheldraht. Dieser höchst selektive Ausschnitt der Realität eines serbischen „Konzentrationslagers“ wurde massenhaft, in Verbindung mit Schlagzeilen wie „Belsen 92“ (Daily Mirror), reproduziert. 1999 präsentierte der damalige Verteidigungsminister Scharping solche Fotos eines vermeintlichen Massakers an ZivilistInnen – tatsächlich UÇK-Soldaten – als Legitimation des Kriegseintritts. Auch im Laufe des Krieges waren es Bilder des Leids, nunmehr die der Flüchtlinge an den Grenzen des Kosovo, welche die öffentliche Unterstützung sicherten.
Dieser Umgang mit Kriegsbildern markiert einen Paradigmenwechsel in der Vermittlung postmoderner Kriege: Neuerdings wurden Bilder von Kriegsopfern zur Herbeiführung und Legitimation von Kriegen genutzt. So wurde mit Hilfe der Bilder eine Kriegsrealität generiert, die z.B. der mit dem Zweiten Golfkrieg vermittelten diametral gegenüberzustehen schien: Im „sauberen Präzisionskrieg” wurden die Opfer noch ausgeblendet. Jene Realitäten schlossen sich jedoch nicht aus, kam es doch viel mehr auf deren jeweilige öffentlichkeitswirksame Nutzbarmachung bzw. Kontrolle an.
Folgerichtig gehörten serbische TV-Sender und Radiostationen zu den primären Zielen der NATO-Luftangriffe; es galt, sie bei Kriegseintritt an der Verbreitung ihrer Bilder der Folgen der NATO-Bombardements zu hindern. So konnte die NATO ihre hygienisierte Version des luftgestützten Präzisionskrieges, in den NATO-eigenen Medien hauptsächlich über Vorher/Nachher-Satellitenbilder vermittelt, konkurrenzlos präsentieren. Die Kontrolle über die Bilder war kriegsentscheidend: Das Leid der serbischen Bevölkerung wurde unsichtbar gemacht und durch die Erzählung eines Präzisionskrieges – gekoppelt an Metaphern von Heilung in Form chirurgischer Kriegsführung – ersetzt, womit der westlichen Deutungshoheit über den Krieg nichts mehr im Wege stand.
Hinter all diesen konkreten Vermittlungsstrategien scheint ein Kriegsdiskurs auf, der weit mehr beinhaltet als die reine Frage nach einer adäquaten Reaktion auf die Verletzung von Menschenrechten. Vielmehr konstituiert sich innerhalb dieses Diskurses eine Vorstellung des „westlichen Subjekts”, das sich scheinbar offensichtlich als „zivilisiert” (z.B. in Abgrenzung zur „serbischen Barbarei”) in der Wahl der Mittel erweist. Es lehnt Krieg zwar ab, sieht militärische Gewalt unter einer (permanent expandierenden) Reihe von Ausnahmen jedoch legitimiert, was sich auf der vermuteten eigenen zivilisatorisch (-technologischen) Überlegenheit gründet und diese wiederum begründet.
Total Immersion: Authentizität und Entertainment
Da bis ins 19.Jhd. die meisten Kriege in räumlicher Ferne zur Lebenswelt der Bevölkerung lagen, kam der „authentischen”, doch gefahrlosen Vermittlung des Kriegserlebnisses große Bedeutung zu. Dem wurde Mitte des 19.Jhd. versucht, in Form großer Panoramahallen mit Schlachtengemälden im 360°-Radius gerecht zu werden, in denen sich die RezipientInnen „mitten im Geschehen” glaubten. Ihre Popularität wurde jedoch von der aufkommenden Fotografie und ihrem (damals wie heute) überschätzten Authentizitätsversprechen gebrochen. Doch gerade zu Beginn der Fotografie waren es nicht zuletzt technische Hürden wie große Kameras und lange Belichtungszeiten, welche die Möglichkeit einer realistischen Vermittlung gar nicht erst aufkommen ließen und die frühen Fotografen an den Rand der Schlachtfelder drängten. So waren sie gezwungen, die (von Toten gesäuberten) Reste der Schlacht, oder Soldaten im Umfeld ihrer Lager abzulichten; „Kämpfe“ mussten nachgestellt werden.
Doch auch Propaganda war diesen „Abbildern“ eingeschrieben: 1855 schickte der britische König den Fotografen Roger Fenton mit der Maßgabe »No dead bodies!« in den Krimkrieg, um mit Hilfe von Fotos die Unterstützung der britischen Öffentlichkeit zu erstreiten. Die Bilder „nach getaner Arbeit” Wein trinkender Soldaten knüpften unmittelbar an das Genre Militaire an und stanzten jenen Krieg als „Picnic War” ins kollektive Gedächtnis. Mit dem Spanisch-Amerikanischen Krieg (1898) erlangte die Immersion eine neue Qualität: Krieg hielt als „Entertainment“ Einzug in die aufkommenden Kinos und den Alltag der Bevölkerung: In Badewannen inszenierte Seeschlachten wurden als »Best Amusement« oder »Greatest Show on Earth« vermarktet.
Nachdem während des Ersten Weltkriegs primär die militärische Nutzung der Aufklärungsfotografie ausgebaut wurde, nutzten die NS-Propagandastrategen die Macht der Bilder in bis dahin unbekanntem Umfang: Sie führten Propagandakompanien (PK) bei SS und Wehrmacht ein, die sowohl Frontpropaganda betrieben, als auch Rohmaterial oder fertige Beiträge für Rundfunk, Wochenschauen und Zeitungen produzierten. Hierbei verquickten die militärisch ausgebildeten und organisierten PKs Inszenierungen mit „Nachrichten” von der Front. Diesem Material – noch heute oft als neutrale Dokumente interpretiert – ist das nationalsozialistische Weltbild ist jedem Moment fest eingeschrieben. Wurde im NS-Deutschland gar nicht erst zwischen Berichterstattern und Soldaten unterschieden, so verschwimmt jene zwischenzeitlich relativ existente Grenze in der aktuell von westlichen Staaten bevorzugten Praxis des Embedded Journalism, erneut. Nachdem der Vietnamkrieg, als Augenblick einer relativ freien Berichterstattung, zum PR-Desaster für die USA wurde, gingen die westlichen Staaten mit den Kriegen der 80er Jahre zu einer äußerst restriktiven Bildpolitik über, die sich mit der aktuellen Praxis nur scheinbar wieder öffnet: Eine kritische Distanz ist beim Embedded Journalism ausgeschlossen.
Parallel zu dieser Militarisierung des Journalismus schreitet auch die der „Zivilgesellschaft” massiv voran. Nachdem die marktliberalen Reformen die westlichen Armeen und ihre Beschaffungspolitik erreichten, wuchsen neue Synergiegefüge zwischen Militär, Wissenschaft und Unterhaltungsindustrie. Neben Doku-Soap-Formate, die mit pseudo-dokumentarische Geschichtchen aus dem SoldatInnenalltag in Tradition des Genre Militaire unsere Mattscheiben seit einigen Jahren „erobern“, schuf auch der Wunsch der Militärs nach immer leistungsfähigeren Simulationsumgebungen neue Anknüpfungspunkte: Die Computerspieleindustrie entwickelt zu einem Bruchteil der bisherigen Kosten Simulationssoftware für die Streitkräfte, wobei sie die Ergebnisse der subventionierten Forschung kommerziell nutzen dürfen und so riesige Gewinne einstreichen. Aktuelles Zentrum dieser Kollaboration ist das „Institute of Creative Technologies“ der „University of Southern California“: Vom Militär finanziert, bringt es WissenschaftlerInnen aus dem Forschungsbereich der künstlichen Intelligenz mit Kreativen der Unterhaltungsindustrie zusammen. Hier wirkt die Militarisierung der Zivilgesellschaft nicht nur direkt über jene Synergien im Bereich von Markt und Arbeit, sondern dringt mit den von uns konsumierten Unterhaltungsangeboten in den Bereich des „Privaten”.
In der diskursiven Verarbeitung und Ablenkung dessen, was es vom Krieg und vom Frieden zu wissen und zu sagen gibt, dringt der Krieg in unsere Köpfe und Körper – sei es durch von Opfern bereinigte Nachrichtenbilder oder jenes gefahrlose „Spielen“, das uns den Kick todbringenden Heldentums und absoluter Überlegenheit jederzeit nacherleben lässt. Diese im Alltag verankerten Bilder und Erzählungen sind es, welche die (Be-)Deutungen konstituieren, denen wir uns auch mit Verweigerungspraktiken nicht entziehen können. Unsere darauf gründenden Diskurse von Krieg und Frieden sind verknüpft mit Diskursen über gender, race, class, Nation, Sicherheit etc. und zugleich säuberlich von ihnen getrennt. Sie bilden damit die Grundlage unseres alltäglichen Handelns und umgekehrt. Das abendländische Subjekt konstituiert sich so als „Neue Heimatfront” im Kreuzfeuer der Diskurse vom Krieg und vom Frieden.
Streitmacht des Diskurses: Die Verschränkung von Krieg dort und Frieden hier
Bei der demokratischen Legitimation der von westlichen Staaten geführten Kriege ist unerheblich geworden, ob Kriegsführung durch aktive Zustimmung – in der Verknüpfung von sich durch PR verselbständigender Geschichts- und Gegenwartsdiskursen – oder passives Erdulden (70% der hiesigen Bevölkerung lehnen den Afghanistankrieg ab) möglich wird. Von Belang ist nur, dass breite Teile der Bevölkerung das Kriegführen (er-)tragen, und es, jenseits des Sicherheitsdiskurses, für nicht alltagsrelevant erachten. Ausschlaggebend hierfür ist die Vorstellung dessen, was Krieg bedeutet. Hierbei spielen die vielfältigen Strategien und Techniken der Vermittlung eine immer größere Rolle.
In mediokratischen Gesellschaften ist es die Macht der wiederkehrenden und wiedererkennbaren (sprachlichen) Bilder, die den öffentlichen Diskurs zu jenen Themen prägen. Verhandelt wird das Wissen darüber, was Krieg ist, warum, wo und wie er geführt werden kann oder muss. Dabei wird das, was als Krieg, also als Ausnahme gilt und einen gewalttätigen Zustand andernorts beschreibt, von einem Normalzustand hier abgegrenzt. In diesem Diskurs verortet sich das westliche Subjekt und beschreibt sich (in Abgrenzung zum „Anderen”) als rational, zivilisiert, kurzum als „friedlich”. Mit dieser (Selbst-)Bestimmung des abendländischen Subjekts und seiner Diskurse ist nicht ein bloß theoretisch zu beschreibender, regelbestimmter Sprach- und Vorstellungsraum gemeint. Hier wird ein durchaus materieller Raum eröffnet, in dem nicht „nur” Vorstellungen und Ideen, sondern auf deren Basis auch Rüstungsgüter, Bombenhagel, Vertreibungen, Vergewaltigungen und Tote produziert werden.
Aus der Perspektive des abendländischen Subjekts beschreiben Krieg andernorts und Frieden hierzulande konkrete Wirklichkeiten in diskursiv bestimmten gesellschaftlichen Räumen: Hier geht es nicht nur um die ökonomische Überlegenheit des „Westens”, sondern gleichermaßen um das individuelle Überleben als ein bestimmtes Subjekt. Mit der Deutungshoheit über Krieg und Frieden, und der tödlichen Aktualisierung dieser Konzepte geht es also auch um die Aufrechterhaltung des „Friedens” des abendländischen Subjekts – sein (kulturelles) Überleben. Aus dieser Perspektive bedeutet „Friedenssicherung” nicht allein die Durchsetzung einer spezifischen Ordnung an „unzivilisierten Anderen”, sondern die Sicherung dessen, was hierzulande als Frieden gilt: Eine soziale Ordnung, in der kriegerische Werte und Normen wie Einzelkämpfertum am Arbeitsmarkt, Korpsgeist im Betrieb etc. längst das alltägliche Handeln bestimmen.
Die Kriegsbereitschaft des abendländischen Subjekts wird, diskursiv gelöst von jeder tödlichen Wirklichkeit des Krieges, nach Innen wie Aussen erzeugt – in der permanenten, auch widersprüchlichen Produktion unserer Vorstellungen von Normalität und Ausnahme, Frieden und Krieg. Hier scheinen einerseits diskursive Strategien auf, die uns zu dem machen, was und wie wir sind: Männer und Frauen, Deutsche und (neuerdings) Muslime, (Lohn-)Arbeitende und Arbeitslose, stets aber kriegerische Subjekte im alltäglichen Kampf ums soziale Überleben, aber auch zu (Er-)TrägerInnen einer nach außen gerichteten Kriegspolitik, bei der es um Leben und Tod der „Anderen” geht. Verhandelt wird vor allem an den Schnittstellen dessen, was noch vor Kurzem als entgegengesetzt erscheinen wollte (Männlichkeit/Weiblichkeit, Weiß/Nicht-Weiß, Zivilisiert/Barbarisch etc.), jedoch an Eindeutigkeit verliert.
Dabei werden die Widersprüche ins Spiel gesetzt, zwischen denen wir uns täglich neu verorten und an denen wir uns, unsere Vorstellungen und Handlungen auszurichten haben. So hat sich z.B. durch die Inszenierung von gender im Kontext militärischer Bilder die Vorstellung von Krieg und damit dessen, was als männlich oder weiblich gilt, radikal verändert. Sanitäterinnen im Kriegseinsatz jenseits eines tradierten Lazarett-Kontextes verbürgen die Fürsorglichkeit der Kriegsführung. Die verstärkte Abbildung von Feldjägerinnen entkoppelt unsere Vorstellungen von Disziplin, Ordnung und Bestrafung von Willkür und Übergriffen. Auch der Soldat wird z.B. im verständnisvollen Umgang mit „fremdartigen” Kindern und der kameradschaftlichen Unterweisung unterlegener „Alliierter” als freundlicher vermittelt. Jedoch schmälert das keineswegs seinen stählernen Willen, kämpferischen Ehrgeiz und technologische Überlegenheit; Einschreibungen, die in denselben Bildern vom Leben im Krieg, der keiner ist, weil niemand (von hier) schießt und niemand blutet, erkennbar werden. Neuerdings verbindet sich das vorbildhafte Kämpfertum des Soldaten mit dem Attribut der Opferbereitschaft, die in den Berichten über gefallene und traumatisierte deutsche Soldaten aufscheint.
Der Krieg ist allmählich „weiblich” geworden: Unblutig, demokratisch, fürsorglich, weichgezeichnet und erträglich. Der Westen aber, repräsentiert durch „seinen” Krieger, bleibt männlich: Kampfgeist, Einsatz- und Opferbereitschaft, Zielstrebigkeit und Heldenmut bleiben (wie im wahren Leben) die Gebote der Stunde. Demokratisch und genderneutral gelten sie fern der Heimat auf dem – nicht mehr erkennbaren – Schlachtfeld, wie hierzulande im Frieden, dem alltäglichen Kampf Aller gegen Alle.
Das Rauschen des Krieges hörbar machen: Gesellschaftliches Sein und diskursive Intervention
Die in je unterschiedlichen Kontexten aufgerufenen Bilder, die zugleich mit scheinbar unabhängigen Bedeutungsfeldern verknüpft werden, bedienen sich dennoch derselben kulturell verankerten und deshalb wiedererkennbaren Bildmuster, ohne eine explizite Rückbindung an die verschiedenen Kontexte zu verlangen. Gerade weil vermeintlich verschiedene Realitäten abgebildet werden, gerade weil sie nicht aufeinander bezogen werden, obwohl sie aufeinander verweisen darin erst deut- und erkennbar werden, sind die Bilder und Erzählungen vom Krieg und vom Frieden so wirkmächtig.
Unsere Kriegstauglichkeit wird erzeugt, indem sich die Plausibilität des Krieges aus der Vorstellung vom Frieden und den darin kodierten Werten und Normen nährt, indem wir uns in den Bildern vom Krieg selbst wiedererkennen, vor allem aber zugleich davon entkoppeln können. Die unterschiedliche Kontextualisierung gleicher Codes und Vorstellungen ermöglicht, dass wir uns lossagen können von der Realität des Krieges, obwohl unsere eigene Verfasstheit und Erkennbarkeit notwendig von diesem Krieg abhängt.
Jenseits unserer aktiven Zustimmung ist es gerade dieser Krieg, in welchem wir uns als friedliche westliche Subjekte einerseits, unseren Alltag und unsere soziale Ordnung als „Frieden” andererseits wiedererkennen und verteidigen. Wenn unsere Kriegsbereitschaft auf unserer Vorstellung dessen beruht, was als Normalzustand gilt, wenn unsere Vorstellungen von Krieg und Frieden getragen werden von den Selbst- und Fremdzuschreibungen, die wir alltäglich vornehmen, so sind es diese vom Kriegsgeschehen getrennt ins Spiel gesetzten Vorstellungen, welche die „Neue Heimatfront” fundieren. Wird das so konstituierte abendländische Subjekt als Träger dieser kriegerischen Logik und seine Kriegsbereitschaft als Möglichkeitsbedingung der aktuellen Kriegspolitiken anerkannt, so rückt es in den Fokus einer zu entwickelnden politischen Praxis: Diese stille „Neue Heimatfront”, an den Krieg zurückzubinden. Dazu ist es unabdingbar, die Funktionsweisen und Logiken der Kriegsbilder des abendländischen Subjekts aufzustören. Denn die mit dem und durch das Subjekt aktualisierten Bilder von Krieg und Frieden operieren auf dem kollektiven Wissen der Bevölkerungen, auf dessen Basis das kollektive Gedächtnis modelliert wird, welches das kollektive Bewusstsein speist.
Nicht nur PR, auch antimilitaristische AktivistInnen bedienen sich längst diskurs-interventionistischer Methoden: Jeder pink umgestaltete Panzer, jede durch das Einspielen von Kriegslärm umgedeutete Vorführung von Bundeswehr-Orchestern unterbricht das ungestörte Zirkulieren der Bilder eben nicht durch Rationalität und Aufklärung. Vielmehr wird durch die symbolische Rückbindung des Militärischen an vermeintlich andere Diskurse die traditionalisierte und diskursiv abgesicherte Wirkung der Bilder vom Krieg und vom Frieden unterbrochen, und damit die „Neue Heimatfront” vielleicht aufgestört, das Militärische ungenießbar.
Um die Lust der Einzelnen am Krieg, der Frieden scheint, zu thematisieren, bleiben uns Interventionen im Alltag, wie die des britischen Künstlers Banksy oder anderer AktivistInnen, die den öffentlichen Raum – und damit Alltag – mit lebensgroße Bildern von Soldaten und Kriegsgerät als Kriegsrelevant markieren. Dazu ist es notwendig, vermeintlich unabhängigen Diskurse vertraut zu sein, sich ihrer Funktionen und Wirkungen zu bedienen und sie in störender Weise zu verbinden. Gelegenheiten das scheinbar friedliche Rauschen aufzustören und Selbst-gefährdend zu machen gibt es genug: Militärische Musikveranstaltungen, Paraden, Rundgänge etc. Die Bundeswehr übernimmt die Werbung selbst. Wenn auch der Kampf um die Köpfe angesichts der in doppeltem Sinne zu begreifenden Medienfront kaum gewonnen werden kann, so lassen sich dennoch die Bäuche der Heimatfront ins Grollen bringen. Symbolische Diskursinterventionen sind damit nicht lediglich Beiwerk antimilitaristischer Aktivitäten, sondern auf eine Heimatfront gerichtet, die irgendwann möglicherweise das gelegentlich vernehmbare unzweideutige »Nein!« zu Militarismus und Krieg weiterträgt, vervielfältigt und eines Tages das allgemeine Rauschen des Krieges übertönt.
C. Arndt / P. Wix. In: ak – analyse und kritik. Zeitung für linke Debatte und Praxis. Nr. 540 (2009/6); S. 20-21.